Es muss nicht immer eine abhängige Beschäftigung sein. Selbständigkeit ist bei vielen Jobs ebenfalls eine Option, mit Vor- und Nachteilen. Besonders der Start führt dabei oft über die Solo-Selbständigkeit.
In zahlreichen Branchen sind selbständige Arbeitsverhältnisse keine Besonderheit. Für viele Ärzte, Rechtsanwälte oder Architekten ist die eigene Praxis, Kanzlei oder das eigene Büro das Ziel. Aber auch Grafikdesigner, Texter, Journalisten oder Programmierer arbeiten oft selbständig, teils aus Überzeugung, teils aus Mangel an Alternativen.

Unterschieden werden müssen Freiberufler und Gewerbetreibende. Letztere üben Tätigkeiten aus, für die eine Gewerbeanmeldung notwendig ist, wie beispielsweise bei Handelsunternehmen, Handwerksbetrieben und produzierendem Gewerbe.
Für beratende, kreative, wissenschaftliche, medizinische sowie andere ähnliche Dienstleistungen ist dagegen meist keine Gewerbeanmeldung nötig. Das gilt auch dann, wenn Angestellte beschäftigt werden, solange sich die eigene Tätigkeit nicht nur auf Organisation und Leitung beschränkt, sondern weiterhin fachliche Aufgaben umfasst.
Welche Tätigkeiten als "Freie Berufe" anerkannt werden, das ist in § 18 des Einkommensteuergesetzes aufgeführt. Allerdings ist diese Liste der sogenannten Katalogberufe nicht vollständig, und es kommen auch immer wieder neue Berufsbilder hinzu. Im Zweifelsfall entscheidet das zuständige Finanzamt, ggf. auf Grundlage einschlägiger Gerichtsurteile, über die Einordnung als Freiberufler oder Gewerbetreibender.
Eine allgemeine Formulierung der Eigenschaften freier Berufe findet sich im „Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe“:
„Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt.“
Weil Freiberufler kein Gewerbe betreiben, entfällt für sie die Gewerbesteuer. Nur Gewerbetreibende sind von dieser Steuer betroffen.
Gewerbetreibende müssen diese Steuer zahlen, wenn ihr jährlicher Gewinn über dem Freibetrag von 24.500 Euro liegt. Kapitalgesellschaften, also eine GmbH, AG oder UG, zahlen schon ab dem ersten Euro ihres Gewinnes auch die Gewerbesteuer, da für sie dieser Freibetrag nicht gilt.
Der Gewerbesteuersatz beträgt mindestens 7,0 Prozent des zu versteuernden Gewinnes. Zwar nennt das Gesetz einen Grundbetrag von 3,5 Prozent, allerdings wird gleichzeitig von jeder Gemeinde zusätzlich ein Gewerbesteuerhebesatz festgelegt, der bei mindestens 200 Prozent liegt. In den meisten Orten liegt der reale Hebesatz allerdings deutlich höher, im Durchschnitt bei knapp 400 Prozent, was 14,0 Prozent des Gewinnes entspricht (3,5 x 400%). Meistens ist der Hebesatz in Großstädten etwas höher. Dieser liegt in Berlin bei 410 Prozent, in Hamburg bei 470 Prozent und in München sogar bei 490 Prozent (jeweils in 2022).
Um eine zu große Benachteiligung von Gewerbetreibenden gegenüber Freiberuflern zu vermeiden und einen gewissen Ausgleich zu schaffen, kann die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer steuermindernd angerechnet werden, allerdings nur bis zum 4-fachen des Gewerbesteuer-Messbetrages. Verlangt eine Gemeinde eine höhere Gewerbesteuer, dann kann nur der Betrag angerechnet werden, der bei einem Hebesatz von 400 Prozent berechnet worden wäre.
Einkommensteuer muss von Selbständigen genauso wie von Angestellten gezahlt werden. Die Höhe der Steuer in Bezug auf das Einkommen ist identisch. Hinzu kommen auch bei Selbständigen der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Selbständige haben steuerlich allerdings den Vorteil, geschäftlich bedingte Ausgaben besser absetzen zu können.
Freiberufler müssen zwar keine Gewerbesteuer zahlen, unterliegen aber in der Regel der Umsatzsteuerpflicht, d.h. sie müssen auf ihren Rechnungen die Mehrwertsteuer ausweisen und dann an das Finanzamt abführen.
Künstlerische Berufe, wie Musiker, Fotographen, Schriftsteller oder bildende Künstler, können generell oder zumindest mit einigen ihrer Tätigkeiten dem ermäßigten Steuersatz von 7% statt den regulären 19% unterliegen. In einigen Fällen ist auch eine komplette Umsatzsteuerbefreiung möglich.
Von der Umsatzsteuer befreit, sind in der Regel auch medizinische und pflegerische Berufe, also z.B. Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Dentisten, Hebammen oder Krankengymnasten. Bei diesen wichtigen Dienstleistungen im Interesse der Allgemeinheit, sollen die Krankenkassen und auch die Patienten nicht mit der Umsatzsteuer belastet werden.
Den normalen Mehrwertsteuersatz von 19% müssen dagegen freie Berufen wie Architekten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. auf ihre Rechnungen aufschlagen und dann abführen.
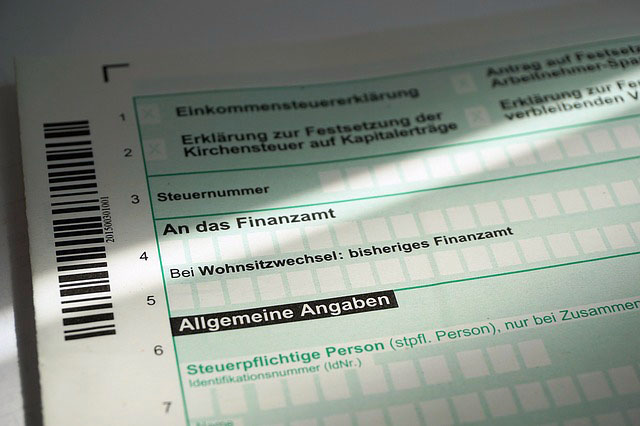
Egal ob Freiberufler oder Gewerbetreibender: Als von der Umsatzsteuerpflicht befreiter Kleinunternehmer gilt, wer im vergangenen Jahr weniger als 22.000 Euro Umsatz gemacht hat und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz erzielen wird. In diese Berechnung fließen allerdings nur mehrwertsteuerpflichtige Umsätze ein, d.h. keine Umsätze aus Tätigkeiten, die grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit sind.
Wer beispielsweise neben seiner mehrwertsteuerpflichtigen Tätigkeit noch Kurse gibt oder Kunstwerke erstellt, muss auf die Einnahmen aus den beiden letztgenannten Tätigkeiten in der Regel keine Mehrwertsteuer aufschlagen. Wenn zum Beispiel ein selbständiger Graphiker, der im vergangenen Jahr 20.000 Euro mit Grafikdesign erzielte, weitere 2.500 Euro mit Kursen an der Volkshochschule und 3.000 Euro durch den Verkauf von Bildern verdient, dann bleibt der Graphiker als Kleinunternehmer mehrwertsteuerbefreit, da nur die 20.000 Euro aus dem Hauptberuf der allgemeinen Mehrwertsteuerpflicht unterliegen.
Werden die Umsatzgrenzen von 22.000 Euro im Vorjahr und 50.000 Euro für das laufende Jahr nicht überschritten, dann dürfen Gewerbetreibende oder Freiberufler, die entsprechend als Kleinunternehmer eingestuft wurden, auf die Ausweisung der Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen verzichten. Im Gegenzug dürfen Kleinunternehmer allerdings die Mehrwertsteuer, die sie selbst bezahlt haben, nicht als Vorsteuer geltend machen, d.h. sie bekommen diese nicht vom Finanzamt erstattet.
Auf die Umsatzsteuerbefreiung kann allerdings verzichtet werden. Das hat den Vorteil, dass die für Betriebsausgaben gezahlte Mehrwertsteuer aus den Rechnungen von Dienstleistern und Lieferanten als Vorsteuer vom Finanzamt zurückgefordert, bzw. mit der Mehrwertsteuer aus den eigenen Rechnungen verrechnet werden kann.
Wer beispielsweise einem Kunden 1.000 Euro Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt und selbst 100 Euro Mehrwertsteuer beim Kauf eines Computers gezahlt hat, der kann die 100 Euro von der zu zahlenden Steuer abziehen bzw. verrechnen und muss nur noch 900 Euro an das Finanzamt abführen.
Das Ausweisen der Mehrwertsteuer hat aber auch mehrere Nachteile. Wer seine Produkte oder Dienstleistungen an Endkunden bzw. Verbraucher verkauft, der verteuert diese Leistungen für seine Kundschaft. Ist die Nachfrage groß genug, um das zu verkraften, dann wäre eine Preiserhöhung meist die bessere Wahl, denn dann fließt das Geld in die eigene Tasche. Oft sind allerdings Unternehmen die Kunden. Diese können die Mehrwertsteuer selbst als Vorsteuer geltend machen und haben daher keine zusätzlichen Kosten.
Ein weiterer, grundlegender Nachteil ist der zusätzliche, steuerliche Verwaltungsaufwand, möglicherweise sogar verbunden mit Mehrkosten für das Steuerbüro bzw. den Steuerberater.
Außerdem sollte man abwägen, ob sich der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung auch finanziell lohnt, z.B. wenn man Existenzgründer ist und den hohen Anfangsinvestitionen eher geringe Umsätze entgegenstehen, sodass der Vorsteuerabzug die Kosten deutlich reduziert.
Wichtig: Wer sich einmal für das Zahlen von Mehrwertsteuer entschieden hat, der bindet sich mit dieser Entscheidung für fünf Jahre und kann so lange nicht wieder zur Kleinunternehmerregelung zurückkehren!
Um die im Laufe eines Jahres bereits angefallene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen (oder erstattet zu bekommen) müssen monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben werden, als Vorauszahlung auf die jährliche Umsatzsteuererklärung, über welche die Umsatzsteuer des entsprechenden Steuerjahres dann endgültig abgerechnet wird.
Für Unternehmensgründer gilt, dass in den ersten zwei Kalenderjahren die Umsatzsteuer-Voranmeldungen monatlich abgeben werden müssen, sofern sie nicht als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit sind. Ab dem dritten Jahr reicht dann eine jährliche Zahlung, wenn die Umsatzsteuer unter 1.000 Euro pro Jahr liegt. Darüber muss quartalsweise gemeldet und gezahlt werden, ab einer Umsatzsteuerlast von 7.500 Euro pro Jahr sogar monatlich. Durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz ist diese Regelung allerdings für Existenzgründer ausgesetzt worden, sodass diese ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen auch in den ersten zwei Jahren nur quartalsweise abgeben müssen, statt so wie bisher monatlich. Diese Maßnahme wurde vom Gesetzgeber allerdings bis auf weiteres bis zum Steuerjahr 2026 befristet.
In der Regel sind Selbständige für ihre Vorsorge im Alter selbst verantwortlich. Sie können eigenständig entscheiden, ob sie freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder private Altersvorsorge betreiben. Es gibt allerdings Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen, für die in den meisten Fällen eine Versicherungspflicht besteht, wie Handwerker, Bildungs- und Pflegeberufe oder Künstler und Publizisten (über die Künstlersozialkasse).
Außerdem gilt für Freiberufler, die in Standeskammern organisiert sind, also beispielsweise selbständig tätige Ärzte, Anwälte, Steuerberater oder Architekten, dass diese sich in dem Versorgungswerk der entsprechenden Kammer eintragen lassen müssen.
Für Selbständige gilt, genauso wie für Angestellte, die allgemeine Krankenversicherungspflicht. Allerdings müssen Selbständige nicht zwingend Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sein. Sie können sich alternativ auch über eine private Krankenversicherung (PKV) absichern. Deren Beiträge sind einkommensunabhängig und richten sich nach Alter, Beruf und Gesundheitszustand. Die Abwägung der Vor- und Nachteile der PKV für Selbständige ist sehr komplex.
Selbständige können auch freiwillig Mitglied der GKV bleiben, was sich vor allem bei einem geringen Einkommen lohnt, das zu eher niedrigen GKV-Beiträgen führt, sowie mit Blick auf das Alter, wenn die Beiträge der PKV meist deutlich steigen. Ist man einmal Mitglied einer privaten Krankenversicherung, dann ist die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung oftmals sehr schwierig bis unmöglich.
Künstlerisch und publizistisch tätig Selbständige bzw. Freiberufler, können sich in den meisten Fällen über die Künstlersozialkasse versichern und haben dadurch Versicherungsbedingungen, die denen von Angestellten ähneln, denn bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge, die an die Renten- und Krankenkasse gezahlt werden müssen. Bei Selbständigen, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, übernimmt diese die Hälfte der Beiträge, was die Sozialversicherung für Künstler und Publizisten natürlich deutlich günstiger macht.
Wer sich selbständig macht, kann von verschiedenen Förderprogrammen profitieren, z.B. für den vergünstigten Zugang zu Krediten, etwa durch die staatliche Förderbank KfW.
Welche Fördermöglichkeiten es gibt, ist auch lokal verschieden bzw. vom Bundesland abhängig. Existenzgründerberatungen, wie es sie beispielweise bei der Industrie- und Handelskammer gibt, können bei der Wahl der richtigen Förderprogramme helfen.
Auch bei den in vielen Städten und Gemeinden vorhandenen Existenzgründerzentren, die beispielsweise günstige Büroräume und Werkstätten sowie Synergien mit anderen Existenzgründern bieten, gibt es Hilfe in Form von Beratung.
Wer Arbeitslosengeld bezieht, kann einen Existenzgründungszuschuss beantragen. Allerdings sollte das rechtzeitig geschehen, denn der Anspruch auf Arbeitslosengeld muss noch mindestens 150 Tage betragen. Außerdem ist es erforderlich, dass eine fachkundige Stelle die Tragfähigkeit der Gründungsidee bestätigt. Das ist meistens die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer, kann aber auch eine Bank sein.
Die Agentur für Arbeit ist nicht verpflichtet, diesen Zuschuss zu gewähren. Es handelt sich um eine sogenannte Kann-Leistung. Zusätzlich muss es sich um eine Vollzeittätigkeit handeln, welche die Arbeitslosigkeit beendet.
Die Höhe des Zuschusses bemisst sich nach der Höhe des bislang gezahlten Arbeitslosengeldes (ALG 1) zuzüglich 300 Euro. Diese Zahlung wird zunächst für sechs Monate geleistet. Anschließend können für weitere neun Monate 300 Euro gezahlt werden.
Wer Arbeitslosengeld 2 („Hartz IV“) bezieht, kann ebenfalls gefördert werden. Zunächst wird nach der Gründung der Selbständigkeit die staatliche Unterstützung weitergezahlt, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten, denn trotz der Bezeichnung als "Arbeitslosengeld 2" ist Arbeitslosigkeit keine Voraussetzung für die Zahlung. Mögliche Überschüsse aus der Selbständigkeit werden allerdings teilweise auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet.
Zusätzlich können zinslose Darlehen für Investitionen beantragt werden, etwa für den Kauf eines Computers, eine Mietkaution oder für das Erstellen einer Website durch einen professionellen Dienstleister. Nur in Ausnahmefällen werden sie als Zuschuss gezahlt. Laufende Kosten wie Löhne und Mieten können nicht gefördert werden.
Voraussetzung ist auch hier, dass die Tätigkeit in Vollzeit ausgeübt wird und die Existenzgründung die Arbeitslosigkeit beendet. Außerdem muss die Idee wirtschaftlich tragfähig sein. Das Jobcenter oder das zuständige Sozialamt können über die Förderung frei entscheiden, es handelt sich also ebenfalls um eine Kann-Leistung.
Ist das Arbeitsverhältnis dem eines Angestellten ähnlich, dann kann das als Scheinselbständigkeit gewertet werden. Ein Problem ist das vor allem, aber nicht nur, für den Auftraggeber.
Die Abgrenzung von Selbständigkeit zu Scheinselbständigkeit ist nicht immer einfach. Allerdings gibt es einige klare Kriterien. Ist ein Auftraggeber für mindestens 5/6 des Umsatzes verantwortlich und entfallen auf diesen auch 5/6 des Arbeitsaufwandes und werden keine Angestellten beschäftigt, dann wird von einer Scheinselbständigkeit ausgegangen. Weitere Kriterien sind, ob feste Arbeitszeiten vorgeschrieben oder Arbeitsmaterialien des Auftraggebers verwendet werden. Auch die Frage, wie weit die Weisungsbefugnis des Auftraggebers geht, spielt eine Rolle.
Wird eine Scheinselbständigkeit festgestellt, beispielsweise bei einer Betriebsprüfung, dann wird der Selbständige wie ein Angestellter eingestuft. Das bedeutet vor allem, dass Sozialabgaben nachgezahlt werden müssen, eventuell zuzüglich Säumniszuschlägen. Die Ansprüche der Sozialversicherungsträger verjähren erst nach 4 Jahren, bei Vorsatz nach 30 Jahren, wobei in diesem Fall zusätzlich sogar ein Strafverfahren eingeleitet werden kann.
Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, ein Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen, um die spätere Feststellung einer Scheinselbständigkeit bei einer Betriebsprüfung zu vermeiden, und damit hohe Nachforderungen oder sogar Strafen.
Selbständigkeit hat zahlreiche Vor-, aber auch Nachteile, stellt allerdings auch spezielle Anforderungen und ist ohne Frage nicht für jeden geeignet.
Viele Selbständige genießen es, ihre Zeit vergleichsweise frei einteilen zu können. Solange die Arbeit gut und pünktlich erledigt wird, gibt es wenig Vorgaben, wie genau etwas passieren muss. Auch wer gerne nachts arbeitet, kann das tun, und wer zwischendurch gerne eine halbe Stunde auf dem Sofa entspannt, kann das ebenfalls machen – solange das Arbeitsergebnis stimmt. Natürlich gilt das nicht für alle Branchen. Wer ein Geschäft mit Kundenverkehr hat, muss bestimmte Zeiten einhalten. Im Durchschnitt arbeiten Selbständige außerdem mehr.
Auch bei der Art der Arbeit gibt es mehr Freiheiten. Natürlich müssen Selbständige darauf achten, was aktuell nachgefragt wird. Trotzdem bleibt oft Spielraum, sich beispielsweise um attraktivere Aufgaben besonders zu bemühen.
Viele Selbständige genießen es außerdem, selbst für ihren Erfolg oder Misserfolg verantwortlich zu sein. Wer eine gute Arbeit abliefert, kann mehr verdienen oder ist schneller fertig.
Oft verdienen Selbständige mehr Geld, wenn auch in der Regel verbunden mit einer hohen Arbeitsbelastung, denn sie arbeiten für die eigene Tasche und nicht für die Tasche des Chefs. Für viele Selbständige hat es einen besonderen Reiz, wenn der Verdienst von den eigenen Ideen und dem eigenen Fleiß abhängig ist, statt weitgehend von Dritten, also wenn man in eine Firma eingebunden angestellt arbeitet.
Selbständige unterliegen zudem meist nicht der Rentenversicherungspflicht. Sie können selbst entscheiden, wie viel und auf welche Art sie für das Alter vorsorgen wollen.
Vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit spricht für viele Menschen gegen eine Selbständigkeit, denn das Geld ist nicht automatisch, so wie in einem Angestelltenverhältnis, jeden Monat zuverlässig auf dem Konto. Bleiben die Aufträge aus, wie in vielen Branchen etwa während der Corona-Pandemie, fällt auch das Einkommen weg.
Auch die Absicherung gegen Arbeitsausfall wegen Krankheit ist schlechter. Zwar bieten die gesetzlichen Krankenkassen Versicherungen für diesen Fall, aber nur wenige Selbständige sind entsprechend abgesichert.
Nicht in allen Fällen bedeutet Selbständigkeit auch ein höheres Einkommen. Freie Journalisten und Texter verdienen beispielsweise meist weniger als ihre angestellten Kollegen und sind in vielen Fällen überhaupt nur selbständig, weil es an festen Redakteursstellen mangelt.
Ob die Selbständigkeit mehr Vor- oder Nachteile bringt, ist von vielen Faktoren abhängig, letztendlich aber immer vom Einzelfall, denn nicht jeder ist vom Typ her dafür geeignet, auf sich gestellt und ohne viele der sonst üblichen Sicherheiten zu arbeiten. Auch erfordert selbständiges Arbeiten ein hohes Maß an Disziplin und Selbstorganisation sowie die Fähigkeit, sich selbst immer wieder motivieren und auch mit unvermeidlichen Rückschlägen umgehen zu können.
Besonders wenn der Partner oder die Partnerin eine gesicherte Arbeitsstelle hat, dann kann eine selbständige Existenz eine gute Ergänzung sein. Das gilt vor allem für Familien und wenn die Selbständigkeit mit zusätzlicher Flexibilität einhergeht. Ist beispielsweise die Frau Beamtin und ihr Partner selbständiger Grafikdesigner, dann kann sie für das verlässliche Einkommen sorgen und er für die in Familien nötige Flexibilität.
Auch als Weg aus der Arbeitslosigkeit ist die Selbständigkeit in vielen Fällen eine gute Möglichkeit, zumal auch Förderungen durch die Agentur für Arbeit möglich sind und das Arbeitslosengeld 2 bei einer selbständigen Tätigkeit weitergezahlt wird, solange die Einnahmen nach Abzug der Freibeträge nicht mindestens so hoch sind wie die staatlichen Leistungen.
Selbständigkeit kann eine gute Alternative zur Festanstellung sein und bietet oftmals gute Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings ist Selbständigkeit mit weniger Sicherheit verbunden und erfordert auch sonst persönliche Eigenschaften wie Disziplin und die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Außerdem müssen zahlreiche gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen beachtet und damit umgegangen werden.
