
Arbeitszeiterfassung ermöglicht es Unternehmen, aber auch Arbeitnehmern, einen Überblick über die abgeleisteten Arbeitszeiten zu behalten. Zweck ist unter anderem sicherzustellen, dass der Lohn auf Basis der erfassten Arbeitszeit korrekt abgerechnet wurde, bzw. die Erfassung von Überstunden sowie von Sonn- und Feiertagsarbeit. Auch die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen und Ruhezeiten muss sichergestellt werden. Allgemein dient die Arbeitszeiterfassung der Einhaltung der im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) festgelegten Vorgaben.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit seinem Urteil vom 13. September 2022 die Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Das BAG bezieht sich dabei auf das Arbeitsschutzgesetz (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG) und dessen Auslegung mit Blick auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) vom Mai 2019, dass den Mitgliedsstaaten vorschreibt, Regelungen zur Dokumentation der Arbeitszeit einzuführen. Die konkrete Umsetzung des EUGH-Urteils blieb dem nationalen Gesetzgeber überlassen, der das Urteil jedoch in Deutschland noch nicht in nationales Recht überführt hatte.

Das Bundesarbeitsgericht hat nun Fakten geschaffen und damit auch den Handlungsdruck auf den deutschen Gesetzgeber massiv erhöht, sodass eine kurzfristige Umsetzung in nationales Recht zu erwarten ist (Stand: Juli 2023). Wie die Regelungen zur Arbeitszeiterfassung im Detail aussehen werden, ist noch unklar, allerdings gilt laut der Urteilsbegründung des BAG nun eine allgemeine Dokumentationspflicht für sämtliche Arbeitszeiten.
Das deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG) hatte zuvor keine durchgängige Dokumentation der Arbeitszeit gefordert. Lediglich Überstunden sowie Sonn- und Feiertagsarbeit mussten erfasst werden, wobei auch hier bestimmte Ausnahmen beispielsweise für leitende Angestellte möglich waren. Außerdem bestand in Deutschland bereits in bestimmten Branchen, in denen Schwarzarbeit verbreitet ist, eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung.
Durch sein Urteil hat das BAG nun aber klargestellt, dass die Pflicht, ein System zur Arbeitszeiterfassung zu schaffen, in Deutschland allgemein gilt. Ob es weiterhin Ausnahmen z.B. für Mitglieder der Geschäftsleitung geben wird und welche Übergangsregelungen für kleinere Unternehmen gelten werden, wurde vom Gesetzgeber noch nicht endgültig festgelegt.
Laut dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) muss die Arbeitszeiterfassung objektiv, zuverlässig und zugänglich sein, weshalb die Arbeitszeiten elektronisch zu erfassen sind. Allerdings hat der EUGH den Mitgliedstaaten hier einen gewissen Gestaltungsspielraum zugestanden, z.B. was die Umsetzung mit Blick auf die Größe von Unternehmen angeht.
Die Arbeitszeiterfassung über handgeschriebene Stundenzettel wird laut dem aktuellen Gesetzentwurf in Zukunft wohl nur noch für kleinere Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern möglich sein, während Betrieben mittlerer Größe absehbar zumindest Übergangsfristen bei der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung zugestanden werden.
Allerdings gibt es heutzutage ohnehin zeitgemäßere Methoden zur Arbeitszeiterfassung als handschriftliche Stundenzettel.
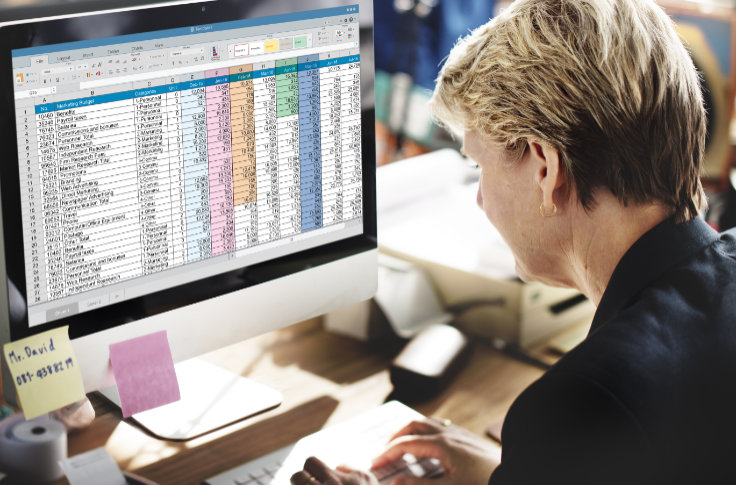
Die Erfassung der Arbeitszeit in Form einer Tabelle in Excel, LibreOffice oder einer vergleichbaren Tabellenkalkulation wird voraussichtlich auch in Zukunft rechtssicher möglich sein. Im Netz werden dazu zahlreiche, oftmals auch kostenlose Excel-Templates angeboten, mit deren Hilfe sich die Eingabe vereinfachen und viele Funktionen und Auswertungen automatisieren lassen, beispielsweise:
Natürlich kann man alle Daten auch selbst organisieren und manuell auswerten, aber das bedeutet einen unnötigen Aufwand.
Wer mit Excel arbeiten möchte, aber kein für die eigenen Zwecke geeignetes Template findet, der kann mit Kenntnissen in VBA (Visual Basic für Applikationen) und Makros selbst eine Arbeitszeittabelle mit Excel erstellen.
Insgesamt muss man allerdings sagen, dass die Arbeitszeiterfassung mit Excel keine wirklich zeitgemäße Methode mehr darstellt, besonders verglichen mit den Möglichkeiten moderner, spezialisierter Softwarelösungen. Für eine kostengünstige Arbeitszeiterfassung in einem kleineren Rahmen, mag Excel aber immer noch in einigen Fällen sinnvoll sein.
Selbst die „Stechuhr“ ist heutzutage in aller Regel eine elektronische Lösung, bei der sich der Arbeitnehmer an einem Terminal an- und wieder abmeldet, z.B. mit Hilfe einer Chipkarte. Durch die starke Verbreitung des Arbeitens im Homeoffice in den letzten Jahren, sind reine Terminalsysteme jedoch häufig nicht mehr zeitgemäß. Es gibt allerdings auch kombinierte Systeme aus Terminals und Software, ebenso wie reine Softwarelösungen, die in der Regel eine mobile Erfassung über Apps oder Mitarbeiterportale ermöglichen.

Solche modernen Systeme zur digitalen Arbeitszeiterfassung bieten heutzutage praktisch immer auch zahlreiche nützliche Zusatzfunktionen. Beispielsweise werden die von solchen Systemen erfassten Daten zur Arbeitszeit direkt an das Lohnabrechnungssystem übermittelt, was die entsprechenden Abläufe wesentlich vereinfacht. Auch die kunden- bzw. projektbezogene Zeiterfassung inkl. Weitergabe an das Rechnungswesen ist oftmals möglich, ebenso wie statistische Auswertungen oder die Verwaltung der Urlaubsplanung sowie von Fehlzeiten. Auch Schnittstellen zu Unternehmenssoftware wie SAP oder zu Branchenlösungen werden angeboten.
Die Aufzeichnung der Arbeitszeiten kann direkt durch den Arbeitgeber erfolgen oder an die Arbeitnehmer delegiert werden. Die gesetzliche Verantwortung bleibt allerdings immer beim Arbeitgeber, d.h. dieser ist verpflichtet, die Erfassung zumindest in Stichproben zu überprüfen, z.B. indem er sich die Daten am Ende der Woche schicken lässt.
Bei einer manuellen Erfassung der Arbeitszeiten durch den Arbeitnehmer kann es außerdem sinnvoll sein, zusätzlich Online-Tools wie einen kostenlosen Arbeitszeitrechner zu nutzen, der Arbeits- und Pausenzeiten detailliert aufgeschlüsselt.
Bei der Vertrauensarbeitszeit steht die Erledigung vereinbarter Aufgaben im Vordergrund, wobei die Beschäftigten ihre Arbeitszeit weitgehend eigenverantwortlich gestalten, ohne dass Anwesenheitszeiten erfasst oder kontrolliert werden.
Auch nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts bleibt diese freie Einteilung der Arbeitszeit weiterhin erlaubt, aber es muss nun auch bei der Vertrauensarbeitszeit eine Zeiterfassung stattfinden. Eine Übereinkunft, dass Über- oder Minusstunden nicht immer ausgezahlt oder vom Lohn abgezogen werden, sofern alle Aufgaben erledigt wurden, darf ebenfalls weiter bestehen. Allerdings gab es hierzu auch bislang schon Urteile und Gesetze, die diese Möglichkeit einschränken. So darf die Arbeitszeit nicht mehr als 48 Stunden pro Woche und nicht mehr als zehn Stunden am Tag überschreiten. Auch sind ab sechs Stunden Arbeitszeit eine halbe und ab neun Stunden eine dreiviertel Stunde Pause vorgeschrieben.
Außerdem hat das Bundesarbeitsgericht in einem älteren Verfahren (Az.: 5 AZR 517/09) beschlossen, dass generelle Festlegungen wie „Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten“ unwirksam sind. In vielen Arbeitsverträgen liest man deshalb die Regelung, dass „Mehrarbeit im üblichen Maße“ nicht ausbezahlt wird. In einem weiteren Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Az.: 5 AZR 331/11) wurde etwa für rechtens erklärt, dass maximal drei Stunden Mehrarbeit pro Woche und 10 Stunden pro Kalendermonat bei einer Vollzeitstelle nicht gesondert ausbezahlt werden, sofern dies im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit vereinbart wurde. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte sich an diesem Rahmen orientieren.
Besonders bei der Vertrauensarbeitszeit kommt es natürlich auch darauf an, die Arbeitszeit möglichst produktiv zu nutzen. Lesen Sie mehr dazu in unseren Artikel zu dem Thema, wie sich die Produktivität durch gutes Zeitmanagement steigern lässt.
Im Bereich des Personalwesens geraten zunehmend zwei unterschiedliche staatliche Vorgaben miteinander in Konflikt, nämlich einerseits die nach stärkeren Kontrollmechanismen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, was beispielsweise bei der Arbeitszeiterfassung die Erhebung personenbezogener Daten erforderlich macht, andererseits müssen aber auch die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden.
Grundsätzlich ist eine datenschutzkonforme Umsetzung der Arbeitszeiterfassung möglich, da hier ein berechtigtes Interesse beider Seiten an einer Erhebung auch personenbezogener Daten vorliegt, d.h. die Unternehmen dürfen Daten wie die Personalnummer und Name der Beschäftigten, Beginn und Ende der Arbeitszeit, Pausen, Urlaubs- und Krankheitstage erfassen.

Bei der Verarbeitung und Auswertung dieser Daten gilt dann allerdings der Zweckbindungsgrundsatz, d.h. dass die Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem sie erhoben wurden, also die Erfassung der Arbeitszeit. Jede darüberhinausgehende Verwendung der Daten sollte rechtlich überprüft und die betroffenen Arbeitnehmer darüber informiert werden. Dies gilt beispielsweise, falls Arbeitnehmer auf Stundenbasis bezahlt und die Daten der Arbeitszeiterfassung dafür genutzt werden, um den Lohn zu berechnen. Auch die Rechtmäßigkeit einer Auswertung der Arbeitszeitdaten, beispielsweise zu statistischen Zwecken, sollte überprüft und die Beschäftigten informiert werden.
Außerdem ist bei dem Umgang mit den Daten zu beachten, dass nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis darauf zugreifen darf, wie die Vorgesetzten des Arbeitnehmers und die Personalabteilung.
Offene Listen beispielsweise, in denen Arbeits- oder Urlaubszeiten für alle Beschäftigten einsehbar dokumentiert werden, sind datenschutzrechtlich hochgradig problematisch und sollten unbedingt vermieden werden, zumal sich aus solchen Daten mitunter weitere Informationen über die Personen ableiten lassen.
Ebenfalls datenschutzrechtlich geklärt werden sollte die Verwendung von Systemen zur Zeiterfassung, die biometrische Daten wie z.B. den Fingerabdruck verwenden oder Personen am Gesicht erkennen. Biometrische Daten fallen in eine besondere Kategorie personenbezogener Daten und dürfen nur unter sehr strengen Voraussetzungen erfasst und verarbeitet werden.
