Wenn die Arbeit so viel wird, dass sie nicht mehr bewältigt werden kann, dann haben Solo-Selbständige mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, weniger attraktive oder lukrative Aufträge abzulehnen. Das kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, etwa nach finanziellen, oder man konzentriert sich einfach auf die wichtigsten und zukunftsträchtigsten Kunden.
Alternativ können die Preise erhöht werden. Dann werden einige Kunden sich neu orientieren und der Arbeitsaufwand sinkt. Allerdings lässt sich das Ergebnis oft nur schwer vorhersehen. Denkbar ist auch, zunächst nur Neukunden höhere Preise zu berechnen oder nur die Kosten für bestimmte Kunden zu erhöhen.
Eine weitere Möglichkeit, um die es im Folgenden gehen wird, ist das Einstellen eines Mitarbeiters. Vor dieser Entscheidung sollten sich Alleinunternehmer über die folgenden Punkte klar werden:
Zunächst sollten Sie sich fragen, ob Sie sich die zusätzliche Arbeitskraft auch langfristig leisten können, bzw. ob die Auftragslage absehbar die Beschäftigung eines Mitarbeiters erlaubt. Denn auch wenn sich die Auftragslage wieder verschlechtert, muss das Gehalt weitergezahlt werden.
Für Unternehmen mit weniger als zehn Angestellten gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Sie können Beschäftigte jederzeit kündigen. Allerdings existiert eine Kündigungsfrist. Außerdem ist es in der Regel mühsam und aufwendig, geeignete Mitarbeiter zu finden. Diese Investition ist natürlich verloren, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder verlässt.
Die Kündigungsfrist beträgt innerhalb der 6 Monate dauernden Probezeit zunächst 2 Wochen zu jedem Tag und ab dem siebten Monat 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Monats. Mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit steigt die Kündigungsfrist dann weiter an. Nach 5 Jahren beträgt sie beispielsweise 2 Monate zum Monatsende, nach 10 Jahren sind es 4 Monate.
Falls die zusätzliche Nachfrage zeitlich befristet ist, beispielsweise als Folge eines Großauftrags, kann auch eine Befristung des Arbeitsverhältnisses sinnvoll sein.
Ist die Auftragslage absehbar wenig stabil, dann kann es unter Umständen vorteilhafter sein, Leistungen bei Bedarf flexibel an Subunternehmer bzw. freie Mitarbeiter auszulagern, statt eigene Angestellte zu beschäftigen, auch wenn man diese gegebenenfalls nur in Teilzeit oder im Rahmen eines Minijobs beschäftigen kann.
Bedenken müssen Arbeitgeber auch, dass Angestellte ein Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben. Außerdem haben Sie bei einer 6-Tage-Woche einen Anspruch auf mindestens 24 Tage bezahlten Urlaub, bzw. bei einer 5-Tage-Woche auf 20 Urlaubstage im Jahr. Der Urlaubsanspruch gilt auch für Minijobs.
Je nach Art und Umfang der zu erledigenden Arbeit kommt entweder eine Anstellung als Minijobber oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung infrage. Auch freie Mitarbeiter können eine Alternative sein.
Einkommen bis 538 Euro fallen unter die sogenannte Minijob-Regel. Hier müssen ca. 30 Prozent des Gehalts vom Arbeitgeber als pauschale Abgabe an die Minijob-Zentrale gezahlt werden.
Besonders lukrativ sind Minijobs für Beschäftigte, denn der Arbeitnehmer muss keine Steuern und Sozialabgaben zahlen, egal ob der Minijob das einzige Beschäftigungsverhältnis ist, oder ein Nebenjob als Hinzuverdienst zu einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung. Deshalb werden Minijobs häufig als Zweitjobs bzw. als Hinzuverdienst zum Familieneinkommen genutzt. Erst mehrere Minijobs addieren sich auf, d.h. erst wenn der Verdienst aus mehreren Minijobs zusammengerechnet mehr als 538 Euro ergibt, dann entfallen die steuerlichen Vorteile.
Um den Übergang vom Minijob zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu vereinfachen, wurde die sogenannte Gleitzone geschaffen. Ab einem Gehalt von 538,01 Euro ist das Einkommen sozialversicherungspflichtig, es wird aber zunächst nicht der volle Beitrag erhoben. Vielmehr steigt der Beitragssatz linear an, bis ab 2.000 Euro dann der volle Satz fällig wird. Grundsätzlich ist ein Midijob also eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Egal ob ein Vollzeit- oder Teilzeit- bzw. Midijob, für die Beschäftigten hat die Sozialversicherungspflicht auch Vorteile. Sie sind krankenversichert und erhöhen durch die entsprechenden Zahlungen Ihren Rentenanspruch. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben außerdem Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn sie in den 30 Monaten vor der Arbeitslosmeldung mindestens 12 Monate lang Beiträge eingezahlt haben.
Grundsätzlich müssen Arbeitgeber 50 Prozent der Beiträge der Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung übernehmen.
Betriebe mit bis zu 30 Beschäftigten müssen zusätzlich noch die Umlage U1 zahlen. Im Gegenzug übernimmt die Krankenkasse dann für bis zu sechs Wochen 50 bis 80 Prozent der Kosten für die Lohnfortzahlung, wenn Beschäftigte erkranken. Arbeitgeber können innerhalb eines Rahmens von 50 bis 80 Prozent selbst wählen, welcher Prozentsatz über die Umlage abgesichert werden soll. Allerdings steigt mit der Höhe der Absicherung auch der Beitragssatz.
Nach sechs Wochen endet die Lohnfortzahlung ohnehin und es wird stattdessen Krankengeld durch die Krankenversicherung gezahlt.
Die Umlage U2 ist ebenfalls verpflichtend. Sie übernimmt die Kosten für die Lohnfortzahlung während des Mutterschutzes. Seit 2008 wird zudem die Umlage U3 zur Finanzierung des Insolvenzgeldes erhoben.
Unter Umständen können auch Kooperationen eine Alternative sein, wenn sich beispielsweise bei größeren Aufträgen zwei Einzelunternehmer zusammentun. Vorhergehende Erfahrungen mit dem Partner sind hier natürlich von Vorteil, da man gegenüber dem Kunden gemeinsam auftritt und die Verantwortung trägt bzw. haftet.
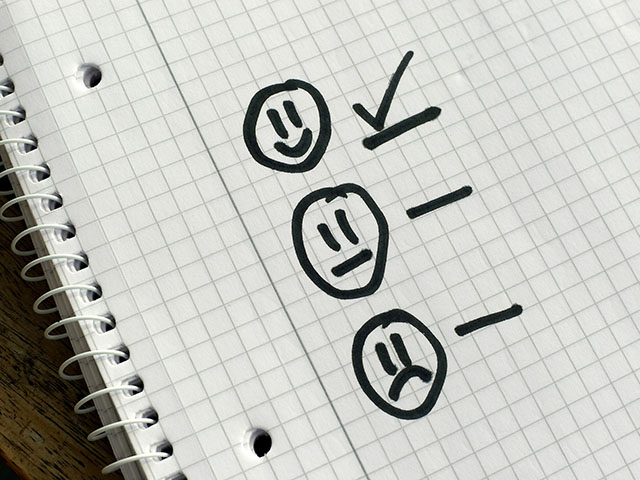
Auch die Beschäftigung freier Mitarbeiter, bzw. die Vergabe bestimmter Teilleistungen an Subunternehmer ist eine Möglichkeit, die Vor- und Nachteile hat. Einerseits sorgt der Einsatz von Subunternehmern für eine hohe Flexibilität. Die jeweils passenden Dienstleistungen können selektiv im erforderlichen Umfang eingekauft werden. Außerdem kann die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer jederzeit gestoppt werden, während Beschäftigte erst gekündigt werden müssen. Der Einsatz freier Mitarbeiter versetzt den Unternehmer oftmals erst in die Lage, einen Auftrag überhaupt annehmen bzw. bewältigen zu können, einerseits weil der Arbeitsaufwand nicht anders zu bewältigen ist, andererseits weil für einen Auftrag evtl. Spezialwissen eingekauft werden muss, über man selbst nicht verfügt.
Doch der Einsatz von Subunternehmern kann auch Nachteile haben. Für Projekte, die einen tieferen Einblick bzw. eine langwierige Einführung des freien Mitarbeiters in die Unternehmensabläufe voraussetzen, sind Subunternehmer weniger gut geeignet. Auch die Möglichkeit direkt auf das Produkt Einfluss zu nehmen ist oft geringer bzw. umständlicher. Obendrein kann die Fluktuation bei freiberuflichen Kräften und Subunternehmern hoch sein, bzw. besteht oftmals das Problem der Verfügbarkeit für anstehende Projekte. Das bindet Ressourcen für die Suche nach Ersatz und bringt auch die Gefahr mit sich, an weniger geeignete freie Mitarbeiter zu geraten.
Auch bei der Beschäftigung freier Mitarbeiter müssen gesetzliche Regeln beachtet werden. Ist ein Auftraggeber für mindestens 5/6 des Umsatzes verantwortlich, dann wird von einer Scheinselbständigkeit ausgegangen. Weitere Kriterien sind, ob feste Arbeitszeiten vorgeschrieben oder Arbeitsmaterialien des Auftraggebers verwendet werden oder ob der Auftragnehmer einer weitgehenden Weisungspflicht unterliegt. Sind diese Kriterien erfüllt, dann kann dies dazu führen, dass die Tätigkeit als Scheinselbständigkeit eingestuft wird. In diesem Fall muss die Person rückwirkend sozialversichert werden, was hohe Kosten bedeutet.
Bei Auftragnehmern aus dem künstlerischen und publizistischen Bereich, etwa Grafikdesignern oder Textern, müssen Abgaben an die Künstlersozialkasse gezahlt werden. 2022 betrug die Künstlersozialabgabe 4,2 Prozent des Auftragswertes.
Am einfachsten ist die Mitarbeitergewinnung, wenn etwa ein ehemaliger freier Mitarbeiter oder ein Praktikant fest eingestellt wird. Auch sich im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis umzuhören, aber auch im Kreis der Geschäftsfreunde, ist oft eine erste, einfache Möglichkeit der Suche nach Mitarbeitern.
In der Regel jedoch, führt nur selten ein Weg daran vorbei, die üblichen Kanäle zur Mitarbeitergewinnung zu nutzen, wie das Schalten von Stellenanzeigen (Online oder Print) oder die Bundesagentur für Arbeit. Auch die offene Stelle auf der eigenen Homepage auszuschreiben, ist in der Regel sinnvoll. Darüber hinaus ist die Mitarbeitersuche in Karriere-Netzwerken wie Xing oder in den sozialen Netzwerken heutzutage weit verbreitet.
Das Internet ist inzwischen die mit Abstand beliebteste Möglichkeit, um Arbeitskräfte zu finden. Die klassische Zeitungsanzeige spielt dagegen kaum noch eine Rolle. Mittlerweile hat sich ein breites Spektrum an Jobbörsen etabliert. Dazu gehören allgemeine Stellenportale, Jobsuchmaschinen, aber auch auf bestimmte Regionen oder Branchen spezialisierte Portale. Das nach der Zahl der Datensätze größte Stellenportal ist aktuell die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Auch sonst ist die Arbeitsagentur immer noch eine wichtige Anlaufstelle für die Vermittlung von Bewerbern. Unter Umständen können von der Arbeitsagentur bei einer Einstellung sogar Zuschüsse gezahlt werden, allerdings überwiegend bei Mitarbeitern mit geringer Qualifikation oder langer Arbeitslosigkeit.
Grundsätzlich muss bei der Einstellung von Beschäftigten die Rechtsform nicht geändert werden. Viele junge Unternehmen starten als Einzelunternehmen. Das bedeutet aber auch, dass sie mit ihrem persönlichen Vermögen für Ansprüche gegen ihr Unternehmen haften.
Die Gründung einer Unternehmergesellschaft (UG), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder einer ausländischen Kapitalgesellschaft erhöht den Schutz des Privatvermögens, auch falls später durch einen Beschäftigten Forderungen gegen das Unternehmen gestellt werden sollten. Allerdings ist das eher die Ausnahme. Der übliche Grund für die Gründung einer haftungsbeschränkten Unternehmensform, ist meist der Schutz des Privatvermögens vor Insolvenz oder auch der Schutz vor Haftung gegenüber den Kunden.
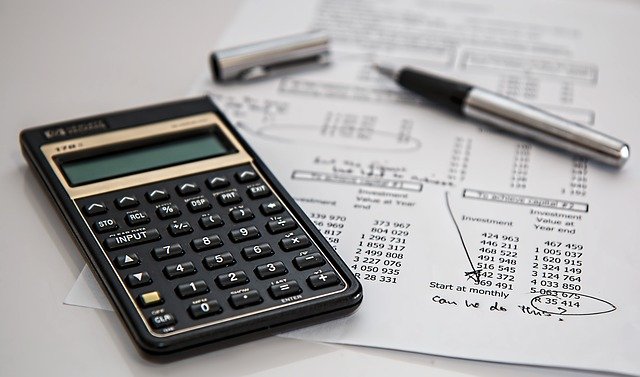
Wie bereits beschrieben, gehen mit der Beschäftigung von Angestellten zahlreiche Pflichten einher, etwa die korrekte Überweisung der Beiträge für die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, aber auch für die Umlagen U1 bis U3.
Für Laien sind die vielen Abgaben kaum zu überblicken. Auch Veränderungen der Beitragssätze sowie mögliche gesetzliche Änderungen müssen im Blick behalten werden. Eine Möglichkeit ist die Vergabe der Lohnbuchhaltung an ein Lohnbüro oder einen Steuerberater.
Preiswerter ist die Verwendung einer Software zum Erstellen der Lohnabrechnung. Moderne Programme unterstützen und führen den Benutzer so, dass der Arbeitsaufwand für die Lohnabrechnung gering bleibt. Die Beitragssätze werden regelmäßig aktualisiert und automatisch berücksichtigt. Außerdem behalten Sie die Daten in der eigenen Hand und haben jederzeit direkten Zugriff darauf bzw. den Überblick. Falls Sie auch Ihre Finanzbuchhaltung selber machen, dann können die Daten in der Regel automatisch in die eigene Buchhaltung übertragen werden.
Wer wachsen will, muss irgendwann eigene Mitarbeiter beschäftigen. Damit gehen aber auch Kosten, Verwaltungsaufwand und Verpflichtungen einher. Solo-Selbständige müssen sich vor allem fragen, ob sie über einen längeren Zeitraum ausreichend Aufträge haben, um die zusätzlichen Kosten zu tragen. Wer Arbeitnehmer beschäftigt, muss sich außerdem mit den Regelungen des Arbeitsrechtes und natürlich auch mit Lohnbuchhaltung befassen. Hier können Lohnprogramme oder die Vergabe der Buchhaltung an ein Lohnbüro helfen.
